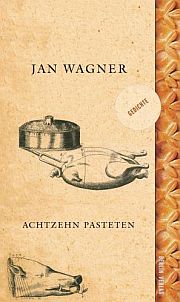So vornehm geht es hier glücklicherweise nicht zu. Die achtzehn „Pasteten“, also Gedichte, die terrine de campagne heißen oder apple pie und dem neuen Band von Jan Wagner den Namen geben, nähmen auch mit einem schmucklosen Tisch vorlieb. Und keine Spur von geschlossenen Räumen und ausgewähltem Publikum. Überall das offene Gelände der sie umgebenden Texte, die von Amerika bis nach Litauen blicken, hinauf zu den Sternen und hinab ins Bergwerk. Alle Jahreszeiten wehen durch dieses Panorama, am nachdrücklichsten der Winter mit dem Schnee, überall funkelt es, nicht nur am Esstisch, und ob die „Pasteten“ das Zentrum dieser lyrischen Landschaft bilden, wird für manche Leser strittig bleiben. Ein Nomadenauge wandert da durch die Welt, das sich mit Vorliebe an Einzelnes, Flüchtiges heftet. Immer fordern uns die Gedichte zum Schauen auf, und immer haben wir das Gefühl, neu zu sehen, obwohl wir doch oft genug durch einen Park spaziert sind, „wo mit grünen eidechsenfüßen / der efeu die wände des schlosses hinauflief...“ Wie frisch gehäutet kommt uns das Sichtbare entgegen, zeigt sich, glänzt und entschwindet wieder. Nur kurz hält der Zug an einer polnischen Station: ... in der ferne ein paar kräne ... seltsames gefühl: die grenze Beispielsweise, wenn ein Gedicht mit dem Titel dezember 1914, also: Weihnachten an der Front, in der ersten Strophe die Halbreime „plem“ und „plum“ enthält, gesplittet aus „plemplem“ und „plumpudding“. Geradezu ein Schock. Dargestellt wird jene Heilige Nacht, in der englische und deutsche Soldaten aufeinander zugehen, reden, rauchen, kommunizieren als herrschte Frieden. Vier Strophen lang menschliche Begegnung, dann die zermalmende Realität: bis kaum etwas im schein der leuchtspurgarben dezember 1914 vollzieht die Bewegung vom harmlosen Beginn bis zum Absacken ins Grässliche, ein klassisches literarisches Muster. Wie intensiv es den Leser zu packen vermag, hängt nicht zuletzt davon ab, ob Identifikationsköder ausgelegt sind. In einem der eindrucksvollsten Gedichte, ikone, spricht ein Ich, mit dem wir fühlen, dessen Wünsche, obgleich wahnhaft, wir teilen, und um so heftiger, je bedrohlicher die Situation des stummen Einzelgängers wird, bis uns die letzte Zeile fast den Kopf wegwenden lässt vor Grausen. Selten hebt Wagner die Distanz in dieser Weise auf, entwickeln die Bilder einen so emotionalen Sog. Oft scheint er gerade die Distanz zu schätzen, als wolle er den Leser nicht einschränken in der Freiheit, sich berühren zu lassen oder nicht. Freilich ist ‚Unmittelbarkeit‘ eine Illusion – ebenso wahr ist, dass der Verzicht darauf das Klima kältet. Das letzte Gedicht, eine Sestine, erzählt von einem Gärtner, der üppig wachsenden Buchsbaum zum „panorama einer ganzen stadt“ zurechtschneidet. Eines Tages ist er verschwunden, die Stadt wird wieder Natur, „hinter dem gatter draußen blüht der buchs“. Hier reflektiert die kunstvolle Form ihre eigenen Grenzen: Alle Artistik bleibt Anekdote inmitten des Wildwuchses und der Vitalität des Geredes. Der Künstler und sein Werk werden nicht vermisst: „von ihm und seinem garten / kein wort mehr.“ Ein düsteres Fazit – freilich war hier der Künstler bloß ein Scherenvirtuose, seine Kunst ein bombastischer Blödsinn. Wagners ironisches Spiel mit der komplizierten Sestinenform macht aus der Düsternis heitere Musik. Perlende Läufe, sozusagen. Dennoch: der „mann aus dem meer“ des Eingangsgedichts und der Buchsbaumschnibbler leben fremd und abgesondert, bis auf „die stunde ruhm“ erfahren beide keinen Zuspruch und hinterlassen nichts – eine schwarze Klammer für so viele farbenfrohe, lebenssatte Tableaus. Und die Pasteten? Erinnern wir uns, dass sie einen Hochzeitstag schmücken. Von Liebe also ist die Rede, von ihrem Kommen und Gehen, ihrem Verlust („...am ohr der hörer, / doch in der muschel nur noch der atlantik...“). Die Eleganz und das Funkeln der Wörter erreichen in manchen Pasteten einen Gipfel. Acht Zeilen, karge Vergleiche und eine kalkulierte Abfolge nachlässiger Reime genügen in cheese and onion pastries, um den Schmerz, das „brennen“ des Herzens, das „sich zurückzieht schicht um schicht“, geradezu körperlich spürbar zu machen. Und durch vol au vent geistern Francesca da Rimini und Paolo Malatesta, Dantes Liebespaar aus dem Inferno, geistert das Flüstern einer weiblichen Stimme – alles ist hier Rascheln, Wirbeln, Wind, Bewegung, bis „irgendwer“ plötzlich „stehen- / bleibt, wie angewurzelt.“ Schönheit ist das, trotz Melancholie und Bitternis. Nicht sehr beliebt in Deutschland, wo das gut Gemeinte mehr Beifall erringt als das gut Gemachte, wo der sinnliche Reiz geschmäht wird und die vermeintliche Tiefe gelobt. Dennoch erneuert sich ja der Hunger danach immer wieder. Und das Glück dieser Lektüre auch.
Gisela Trahms 27.08.2007
|
Gisela Trahms
Interview
Bericht
Prosaminiaturen
|