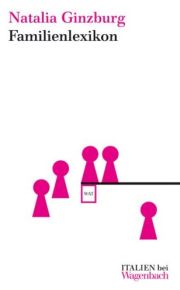Wer eine düstere Saga familiärer Unterdrückung erwartet, wird enttäuscht. Die Levi sind einfach eine großbürgerliche Familie mit einem eigensinnigen Vater und einer immer heiteren Mutter, die Lohengrin liebt und Proust (»Das muss ein Simpel gewesen sein!«). Die ältere Tochter heiratet den Olivetti-Erben, die jüngere den bedeutenden Essayisten Leone Ginzburg, ein Sohn flieht während des Faschismus nach Paris und heiratet dort die Tochter Amedeo Modiglianis – aber innerhalb des Buches spielen Ruhm oder Reichtum keine Rolle. Wichtiger sind das Dienstmädchen Natalina, die Hausschneiderin Tersilla, die Freunde der Eltern, die der Kinder und dazu eine verwirrende Zahl von Onkeln, Vettern, Tanten und Großtanten... Ja, wen interessiert das? Ist das nicht langweilig? Eben nicht, und das ist Teil des Wunders. Das Lexikon enthält keine Lebensdaten, keine langatmigen Personenbeschreibungen. Vielmehr lernen wir die Familienmitglieder durch ihre ‚berühmten Sätze' kennen. Durch sie wird etwa die Großmutter Emma weitergereicht von Generation zu Generation. »In diesem Haus wird alles zum Bordell!«, heißt ihr markantester Spruch. »O du arme Lidia!«, summt Mutter Lidia, wenn sie sich trösten will. »Ein neuer Stern steigt auf!«, ruft der Vater, wenn die Kinder einen unbekannten Freund mitbringen. Solche Sätze füllen das Familienlexikon, durch sie definiert sich die Familie noch, als die Kinder erwachsen sind, in alle Winde zerstreut und einander nicht immer wohlgesonnen. »Ein Wort oder ein Satz genügt: einer jener Sätze, die uns, als wir Kinder waren, unendliche Male wiederholt wurden, um mit einem Schlag unsere alten Beziehungen, unsere Kindheit und unsere Jugend wiederzufinden.. Diese Sätze sind wie die Hieroglyphen der Ägypter, Zeugen einer Lebensgemeinschaft, die aufgehört hat zu sein, aber in Texten weiterlebt, und die fortbestehen wird, solange wir leben.« Der Code einer Familie, ihre Privatsprache: in diesem Buch verfolgen wir, wie Eltern und Geschwister aus ihren Sätzen auferstehen, und während wir lesen, rumoren schon die geflügelten Worte der eigenen Familie in der Erinnerung. Und da auch noch das Banalste, was die Personen von sich geben, mit Ausrufezeichen versehen ist, wirken diese Äußerungen wie lauter komische kleine Explosionen. Komik und Absurdität durchziehen das ganze Buch, obwohl die Zeiten und Zustände schlimm sind und Natalia Ginzburgs Blick scharf bis zur Unerbittlichkeit. Erzählt wird die Epoche zwischen 1920 und 1960, also Faschismus, Verbannung, Krieg, Nachkriegszeit. Der Schauplatz ist Turin, wo die intellektuelle Elite Italiens lebt, viele davon aktiv im Kampf gegen das Regime, auch Natalias Vater und die Brüder wandern für einige Monate ins Gefängnis. Später gründet Giulio Einaudi hier seinen Verlag, in dem Cesare Pavese und Natalia arbeiten und viele wichtige Autoren Italiens ihre Bücher veröffentlichen. Es ist eine Zeit des versuchten Neubeginns, der bald enttäuschten Hoffnungen, und doch, im Rückblick, eine Zeit intensiver Freundschaften und Begegnungen. Und hier endlich, wenn sie über den Verlag und die Kollegen spricht, spricht Natalia auch von sich selbst. Tatsächlich bringt sie es in der ersten Hälfte des Buches fertig, eine Biographie ihrer Familie zu schreiben, in der sie selbst so gut wie nicht vorkommt. Wie hat sie als Kind die Zornesausbrüche ihres Vaters verkraftet? Wie ist sie mit der Einsamkeit des Nachkömmlings fertig geworden? Schweigen. »Natalia ist so verschlossen!«, klagt die Mutter. Der brillante junge Leone Ginzburg wird als Freund ihrer Brüder eingeführt (»Ein neuer Stern geht auf!«), dann hören wir, was Vater und Mutter über ihn sagen (»Er ist hässlich!«), später erfahren wir, dass er im Widerstand arbeitet, und schließlich folgt, aus heiterem Himmel, der Satz: »Leone und ich heirateten«. Sie ist 21 Jahre alt, über ihre Gefühle verliert sie kein Wort. Die beiden werden in ein Dorf in den Abruzzen verbannt, bekommen drei Kinder. Leone, unter falschem Namen nach Rom zurückgekehrt, wird verhaftet und gefoltert. Er stirbt im Februar 1944 im Gefängnis. Da ist Natalia 27. Immer hatte sie geschrieben, erst für die Schublade, dann für den Verlag. Die Kritik schätzte ihre Bücher. Eugenio Montale, der spätere Nobelpreisträger, urteilte: »Es ist kurios zu bemerken, wie unglaublich wahr alles bei ihr ist...; wie bei ihr die Poesie aus der nacktesten prosaischen Trostlosigkeit entsteht.« Das genau kennzeichnet ihre Bücher, besonders das Familienlexikon. Mit diesem Buch kommt der Erfolg, auch beim Publikum. Es entsteht in Rom, wohin sie ihrem zweiten Mann gefolgt ist. Sie schreibt inmitten der Unruhe ihrer Familie und eines großen Freundeskreises, auf dem Sofa, eilig, mit der Hand. So ist sie auch auf dem Foto zu sehen, das das schöne Nachwort ihrer Übersetzerin Alice Vollenweider beschließt. Durchdringend, aber nicht unfreundlich schaut Natalia Ginzburg den Leser an. Mach dir keine Illusionen, scheint sie zu sagen. Die Zeiten sind übel. Familien lösen sich auf, jeder muss ein eigenes Leben leben. Aber wie merkwürdig ist das alles! Und sollten wir nicht trotzdem lächeln, da ja die Worte weiterleben, die nichtigen vor allem? Macht keine Sudeleien!, donnerte mein Vater. Ich schreibe es auf und schon ist er da. Vor einigen Jahren entdeckte ich in einer Turiner Buchhandlung einen dicken Band mit dem Titel Berühmte Turiner. Sofort suchte ich Natalia Ginzburg im Register und schlug die entsprechende Seite auf. Es handelte sich um das Kapitel über Leone Ginzburg, und in einem Halbsatz wurde erwähnt, wann Leone Natalia heiratete. Das war alles. Wer auch immer dieses Buch verfasst haben mag – was für ein unglaublicher Simpel!
Gisela Trahms 23.07.2007
|
Gisela Trahms
Interview
Bericht
Prosaminiaturen
|