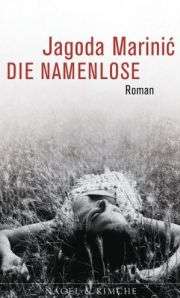 |
|
Jagoda Marinić
Die Namenlose
Roman
Nagel & Kimche 2007
|
Die Namenlose kann als eine typische Berlingeschichte gelesen werden: Ein dreiunddreißigjähriges emotional verkümmertes weibliches Ich ist aus der Provinz vor den alkoholkranken Eltern nach Berlin geflohen. Es arbeitet jetzt als Bibliotheksangestellte in einer Stadtteilbibliothek, die bald geschlossen wird, weil der Bibliotheksbestand in eine größere Bibliothek eingegliedert wird, ebenso wie das Ich von der Provinz aus in einen größeren Einwohnerbestand eingegliedert wurde. Das Ich hasst Kultur, Kino, Theater und seine Mitbewohner Paul und Juliana, die Müsli essen und sich gut miteinander verstehen.
Die Namenlose kann ebenso als eine typische Liebesgeschichte gelesen werden: Nachdem das emotional verkümmerte Ich zur Genüge vorgestellt ist, soll es erweckt werden, und zwar von Ivan, der alle ungeraden Tage der Woche im
Cherche Midi arbeitet und in seiner Freizeit Bücher aus der Bibliothek entleiht. Ivan erkundigt sich nach dem Lieblingsbuch des Ichs, aber er hat keine Chance: Das Ich plädiert „für ein plotfreies Leben“ und vermeidet deshalb die Begegnungen mit Menschen und Männern. „Nur Romanzen, aus denen nichts wird, sind angenehme Romanzen“, findet das Ich.
Wäre
Die Namenlose eine typische Berlingeschichte und eine typische Liebesgeschichte, müsste man sie weder lesen noch besprechen. In Wirklichkeit ist sie alles andere als das. Jagoda Marinić erzählt die Geschichte so ausgefeilt auf zwei Ebenen, dass sich beim Lesen ein Schwindelgefühl einstellt, ein angenehmes Schwindelgefühl allerdings. Das Ich zerfällt in zwei Teile, die abwechselnd aus seinem Leben berichten: ein Tag-Ich, das in der Bibliothek arbeitet und hasserfüllt seine Umwelt und den Erretter Ivan betrachtet, und ein Nacht-Ich, das etwas Verdrängtes, Vergessenes darstellt, genauer: „Ich bin der Teil der Namenlosen, der ihren Schmerz aus dem Zwischenreich ans Licht bringen müßte.“
Etwas ist vorgefallen im Tag-Ich, das es versteinern lassen hat. Von dem, was vorgefallen ist, weiß nur noch das Nacht-Ich. Versteinert funktioniert das Tag-Ich zusehends schlechter, verkappt sich immer mehr in seinen distanzierten Blick auf die Welt und auf sich selbst, während das Nacht-Ich versucht, dem Tag-Ich „die Geschichte, die mich ... in die Nächte verbannt hat,“ wieder zugänglich zu machen, um es mit Schmerz oder mit Liebe, zumindest jedoch mit irgendwelchen Emotionen zu füllen. Es wird wenig erzählt, es wird hauptsächlich metafiktionalisiert, es werden Zustände problematisiert und durch die beiden Ichs gespiegelt. Das klingt extrem kompliziert, pathetisch, überkonstruiert und ein wenig kitschig – und es ist dies alles auch, aber vor allem ist es eines: perfekt durchdacht.
Denn erzählen möchte Marinić wenig, sie möchte vor allem zeigen. Bereits auf den ersten Seiten des Romans ist von einer „unerzählbaren Geschichte“ die Rede, und durch das Tag-Ich – die Bibliothekarin, die eine Diskussion über Literatur belauscht – lässt Marinić den Leser an ihrer Poetologie teilhaben: „Nach heutigem Verständnis braucht eine Geschichte weniger denn je so etwas wie einen Plot. ... Ein Plot motiviert nicht einmal zum Weiterlesen. Ein Plot hindert den Leser lediglich am Aufhören.“ Im letzten Viertel des Romans allerdings führt Marinić diese Poetologie ad absurdum, indem sie das Ich eine Entwicklung durchmachen lässt: Es versöhnt sich mit der alkoholkranken Mutter, und es verbringt zwei Abende mit Ivan. Aber schließlich stagniert die Entwicklung, das Nacht-Ich schreibt: „Es ist uns gelungen, ... sie dazu zu bringen, das sie fühlen will.“ Marinić hat keinen Entwicklungsroman geschrieben, sondern einen merkwürdigen, ungewöhnlichen, verschwurbelten – ja, was eigentlich? Ein Roman jedenfalls ist es nicht.