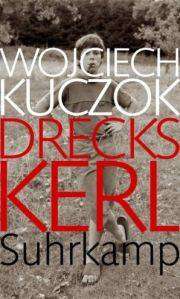Dabei ist vom gesellschaftlichem Background scheinbar nur am Rande die Rede. Im Mittelpunkt steht die Familie K., wobei das Initial vieldeutige Assoziationen – vom abgekürzten Familiennamen des Autors, der sich freilich eingangs beeilt, jedwede Ähnlichkeit des von ihm Erzählten mit existierenden Fakten oder Personen ins Reich des Zufalls zu verweisen, bis zur berühmten Kafkaschen Romanfigur – zulässt. Zunächst jedenfalls, in den dreißiger Jahren, da das Haus für die Sippschaft unter der Regie des Großvaters entsteht – der Enkel, der letztendlich dem Leser die Geschichten weitererzählt, wird erst viel später geboren werden –, läuft alles gewaltfrei und nicht ohne Witz. Histörchen reiht sich an Histörchen in einem „Damals“ überschriebenen ersten Romanteil, in dem man sich manchmal vorkommt wie im mythischen Macondo des Gabriel García Márquez oder auf anderem magisch- Wehmutsvoll und mit viel Humor wird dieser (guten) alten Zeiten jedenfalls gedacht, denn der „Dann“ überschriebene zweite Teil des Buches ist ganz dem perversen Verhältnis des „alten K.“ zu seinem Sohn gewidmet, der sich als Erzähler nun auch in der Ich-Form präsentiert. Damit wird die Distanz, die der erste Buchabschnitt mit seinem auktorialen Erzählgestus herzustellen wusste, mit einem Schlag brutal aufgehoben. Man ist dabei, unmittelbar, ja fast körperlich, wenn der Vater die Peitsche sausen lässt, den Sohn verhöhnt und erniedrigt. Kuczok schafft es mit einer genau benennenden Sprache, den Leser an den Qualen des Heranwachsenden zu beteiligen, ohne dass sich ihm dabei die letzten Ursachen von Hass und Gewalt erschlössen. Das tun sie aber auch für den Sohn nicht, der sich, vollkommen ausgeliefert in all seiner Schwäche, in Rachefantasien hineinsteigert, Kriege herbeisehnt für die Zukunft, in denen er seinem Erzeuger dann von der Seite des Feindes aus entgegentreten könnte. Als eine solche Fantasie der Vergeltung und Rache am Vater muss man wohl auch den letzten und zugleich kürzesten Part des Textes lesen. In einem apokalyptischen Szenario lässt der Sohn alles ihm Verhasste untergehen. Nach einem sintflutartigen Regen halten die überlasteten Abflussrohre des vom Großvater erbauten Hauses dem Druck nicht mehr stand. Die Jauchegrube läuft über und drückt Massen von Kotbrühe in die Kellerräume, von wo sie schnell nach oben steigt. Am Ende neigt sich das unterspülte Haus, seine Fundamente geben nach und es bricht in sich zusammen. Während Sohn und Mutter samt allen Nachbarn – denn allein ihr Haus ist von dem Unwetter betroffen – dem Fiasko von draußen zusehen, kommt der „alte K.“ zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder in den Trümmern zu Tode. Allein das sollte man nicht als versöhnlichen Schluss verstehen. Denn um Versöhnung geht es Wojciech Kuczok nicht. Im Gegenteil. Das Buch ist auch ein Dokument der Beschädigung eines Menschen über den Tod seines Peinigers hinaus. Denn nichts wird gut. Auch nicht nach dem tatsächlichen Tod des „alten K.“, den der Erzähler offensichtlich für so belanglos hält, dass er ihn uns gar nicht mehr mitteilt. Was den Vater betrifft, so verschwindet er nach dem erträumten Untergang des Hauses K. für immer aus dem Text. Was den Sohn betrifft, so findet er keine Ruhe und kann das Gewesene nicht vergessen. Mit dem von Marcel Proust entliehenen Satz „Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen“ leitet der Autor den letzten Abschnitt seines Romans ein. Doch der Schlaf, den sein Protagonist findet, ist ein trügerischer. Einer, in dem das Haus der Kindheit und Jugend wiederersteht und Fluchtreflexe erzwingt. Und auch alles andere, worin er sich versucht, kann ihn nicht von den Traumata seiner Kindheit befreien. Nicht die Ehe. Nicht die Religion. Nicht das Herumvagabundieren. Nicht die eigenen Kinder. Kuczoks Ich ist immer auf der Flucht, „in alle Richtungen zugleich“ und ohne eine Chance des Entkommens. Dreckskerl ist ein Wurf, wie man ihn nur noch selten zu lesen bekommt. Ein ganzes Jahrhundert hat Wojciech Kuczok in ein Haus gestopft und seine Zumutungen, hochfahrenden Erwartungen und jäh abstürzenden Hoffnungen gnadenlos personalisiert. Die Bilanz? Vernichtend. Aussichten? Keine. Große Literatur eben.
|
Dietmar Jacobsen
|