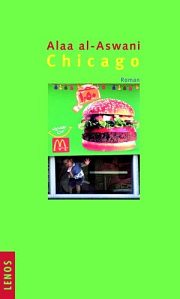Kaum anders geht es all jenen Landsleuten, auf die Schaimâ nach und nach stößt. Auch sie sind Ausgesetzte in der Fremde, Emigranten, denen die Assimilation schwerfällt oder die sich – ganz im Gegenteil – als zweihundertprozentige Amerikaner gebärden, nur um schließlich festzustellen, dass ihr Leben in der Neuen Welt auf einem Selbstbetrug gründet. Ägypter fern der Heimat bilden das Hauptpersonal des aktuellen Buchs von Alaa al-Aswani. Erneut arbeitet der Autor des Weltbestsellers Der Jakubijân-Bau mit einem einfachen, deswegen aber nicht weniger wirkungsvollen ästhetischen Trick. Hat er in seinem inzwischen auch erfolgreich verfilmten Romanerstling ein traditionsreiches Haus und seine Bewohner in der Kairoer Altstadt dazu genutzt, einen so spannungsgeladenen wie tabulosen Blick auf die zerrissene ägyptische Gesellschaft unserer Tage zu werfen, wendet er sich mit Chicago nun dem Problem des Aufeinanderstoßens unterschiedlicher Kulturen zu. Jene Menschen, deren Lebenswege das Buch für eine kurze Zeit begleitet, leben – teils schon Jahrzehnte – in der Fremde. Es sind knapp 20 Personen – ein Verzeichnis zu Beginn der deutschen Übersetzung von Hartmut Fähndrich stellt sie in aller Kürze vor und macht es dem Leser leichter, in einen komplexen Erzählkosmos voller ungewöhnlicher Namen einzudringen –, deren Schicksale der Roman miteinander verflicht – Professoren und Stipendiaten, deren Freunde und Rivalen, Ehefrauen und Geliebte, Kinder und all jene Angehörigen, die man in der Heimat zurückgelassen hat. Ihr Treffpunkt ist das Histologische Institut der Chicagoer Universität – ein Ort, den al-Aswani aus eigener Anschauung gut kennt, denn in Chicago hat der heute als Arzt, Journalist und Schriftsteller in Kairo Lebende einst Zahnmedizin studiert. Allerdings begrenzt der Roman seine Schauplätze nicht auf Hörsäle und Seminarräume. Schnell spannt er sein erzählerisches Netz aus über die gesamte ägyptische Diaspora in Amerika, bezieht Figuren jeglicher politischen Couleur mit ein und gipfelt in einem Besuch des Präsidenten Mubarak bei seinen Landeskindern jenseits des Atlantiks. All das bietet Alaa al-Aswani reichlich Gelegenheit, mit Korruption und Liebedienerei, religiösen Fesseln und überholten Eheauffassungen, gesellschaftlichen Hierarchien und den Vorteilen, die ein schmieriger Opportunismus bringen kann, abzurechnen. So viel Ägypten- und Islamkritik aber auch in den Roman eingeflossen ist, zeigt das Scheitern jener Figuren, die sich scheinbar völlig von ihrem Herkommen gelöst und die westliche Lebensweise angenommen haben, aber doch, dass dies der falsche Weg ist. Und mit der Figur des Nâgi Abdalsamad, der als Einziger Ich sagen darf und eine Art Selbstporträt des Autors darstellt, wird zusätzlich für aktive Opposition und das Festhalten am Traum von einem demokratischen Ägypten plädiert. Chicago müht sich um keinen ultramodernen Erzählstil. Wie in den europäischen Romanen des 19. Jahrhunderts thront über allem Mitgeteiltem ein Gott gleicher Erzähler, dem noch die geringsten Regungen in den Seelen seiner Figuren bekannt sind. Allerdings vermischt al-Aswani den traditionell eher zu Tempoverschleppung neigenden Darbietungsgestus der klassischen Realisten mit der Geschwindigkeit, ja Unrast unserer Tage. Gewisse Methoden des Spannungsaufbaus wie das Unterbrechen eines Handlungsstrangs an seinem nach Auflösung schreienden Höhepunkt, um zunächst eine andere Episode fortzuspinnen, scheinen zudem direkt den Soapoperas aus den Vorabendprogrammen abgeschaut. Und ein paar jener tabubrechenden Provokationen, für die der Autor inzwischen bekannt ist, hätten unter dem Gesichtspunkt der erzählerischen Ökonomie ruhig weniger Raum einnehmen dürfen. Alles in allem freilich bringt uns dieser Roman eine fremde Welt auf ebenso unterhaltsame wie atemberaubende Weise näher. Er zieht uns hinein in die Widersprüche zwischen Tradition und Moderne, Ost und West, Heimat und Fremde. Und wenn er auch gelegentlich überspitzt, so zeigt er sich doch von einer großen Sehnsucht getragen, jenseits der scheinbar immer tiefer aufreisenden Gräben der Gegenwart Raum für Neues zu erkunden.
|
Dietmar Jacobsen
|